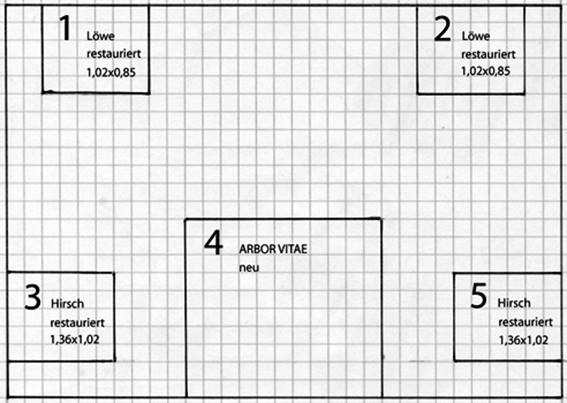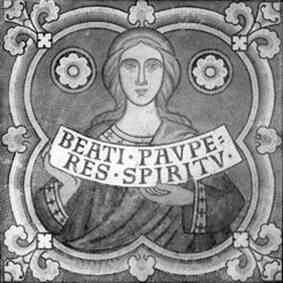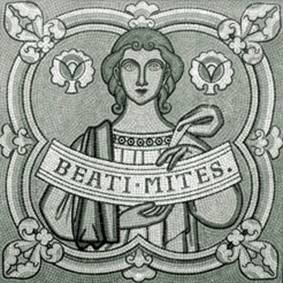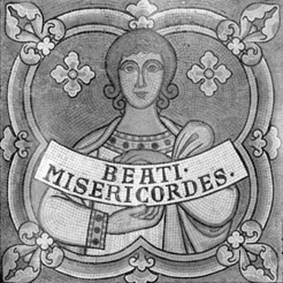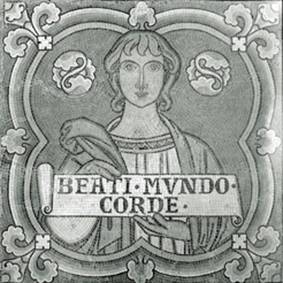Wilhelm Joliet
Die Geschichte der Fliese
Mettlacher Platten- und Stiftmosaikbeläge
in der Kölner Kirche Groß St. Martin
|
Groß St. Martin und Stapelhaus am
Fischmarkt, um 1900 |
Groß St. Martin ist eine der zwölf großen romanischen Kirchen in Köln. Die dreischiffige Basilika mit ihrem kleeblattförmigen Ostchor und dem quadratischen Vierungsturm mit vier Ecktürmchen ist eines der markantesten Wahrzeichen im linksrheinischen Panorama der Stadt Die Basilika errichtete man im 12.
Jahrhundert auf Fundamenten römischer Bauten. Sie diente über
mehrere Jahrhunderte als Kirche einer Benediktinerabtei. Nach der
Säkularisation des Klosters am 21. September 1802 wurde sie
Pfarrkirche. |
Groß St. Martin wurde im Zweiten Weltkrieg nahezu
gänzlich zerstört. Der Wiederaufbau begann 1948 und dauerte bis 1985.
Die
Altarweihe fand am 22. Juni 1985 statt.
Diesen
Bericht widme ich meiner Vaterstadt Köln, die aus Trümmern des Zweiten
Weltkrieges wiedererstand.
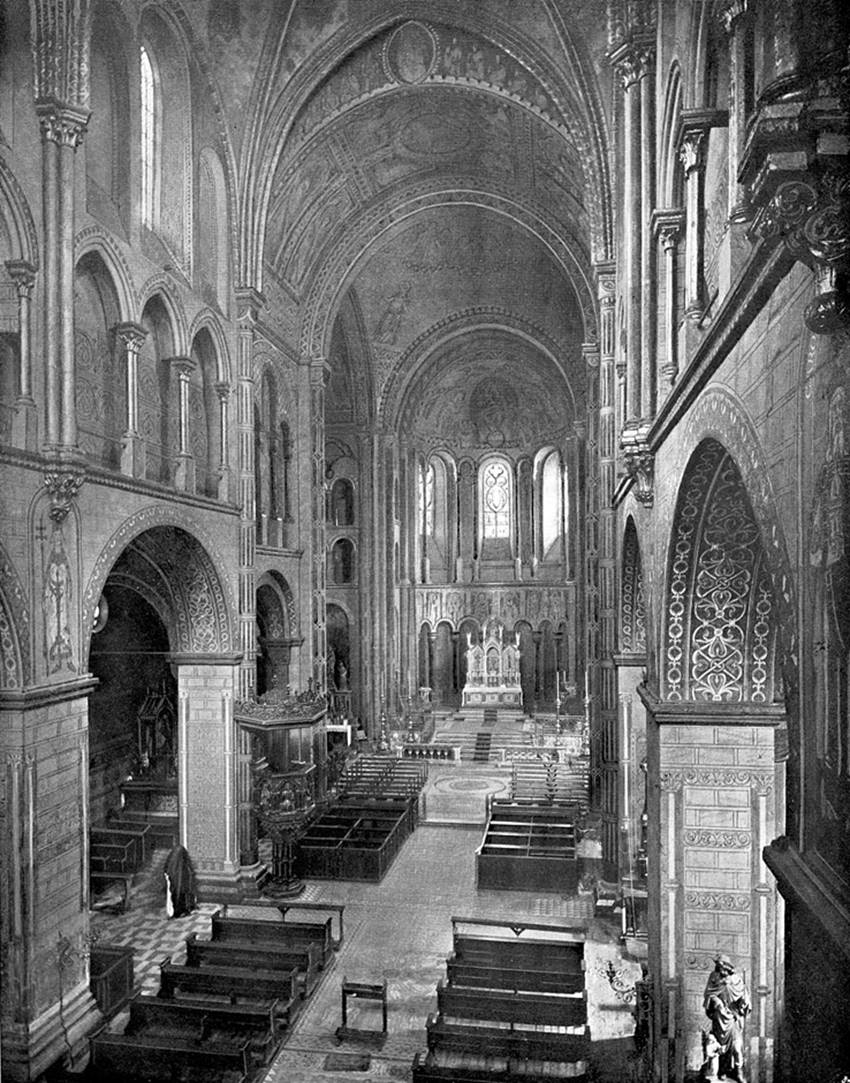 02
02
Groß St. Martin in der Ausstattung von August Essenwein.
Hauptschiff Richtung Ostkonche (vor 1899) mit Mettlacher Platten- und
Stiftmosaikbelägen.
August Ottmar Essenwein (* 1831-+1892), Architekt,
Bauhistoriker und Direktor des Nürnberger Germanischen Museums entwarf die
klassizistische Ausschmückung von
Gewölben, Wänden und Boden der Kirche. Seine Vorstellungen
erläuterte er in der Veröffentlichung
„Die innere Ausstattung der Kirche
Gross - St. Martin in Köln. Entworfen von A. Essenwein, Nürnberg, v.
Ebner’sche Buch- und Kunsthandlung, 1866.“
Umgesetzt wurde der große Ausschmückungsplan in vereinfachter Form seit
1868 durch den Kölner Maler Alexius Kleinertz (*1831 - +1903). Kleinertz
schmückte mehrere Kölner Kirchen aus. Zu seinen bedeutendsten Arbeiten
gehört aber die Ausmalung der Kirche Groß St. Martin.
 03
03
Blick in die Nordkonche (vor 1899). Auffallend ist die unterschiedliche
Gestaltung der keramischen Bodenflächen.
In einem 1894 von Villeroy & Boch in Mettlach
herausgegebenen Verzeichnis der
größeren öffentlichen Bauten in welchen Mettlacher Mosaik- und
Wandplatten, Verblender sowie Stiftmosaiken seit 1852 ausgeführt worden
sind fand ich Einträge zu Mosaikplatten- und Stiftmosaikbeläge in der
Kirche Groß St. Martin.
Im Werksarchiv liegt ein sogenanntes ‚Arbeitsbuch‘ des Mitarbeiters von
Villeroy & Boch Jacob Bach. Er
verlegte keramische Bodenflächen in der Kirche Groß St. Martin
1884
vom 26. November bis 24. Dezember 1884,
1885
vom 07. März bis 02. April und vom 18. Juni bis 01. August und
1886
vom 18. Januar bis 24. Februar.
Bodenbeläge aus
Mosaikplatten
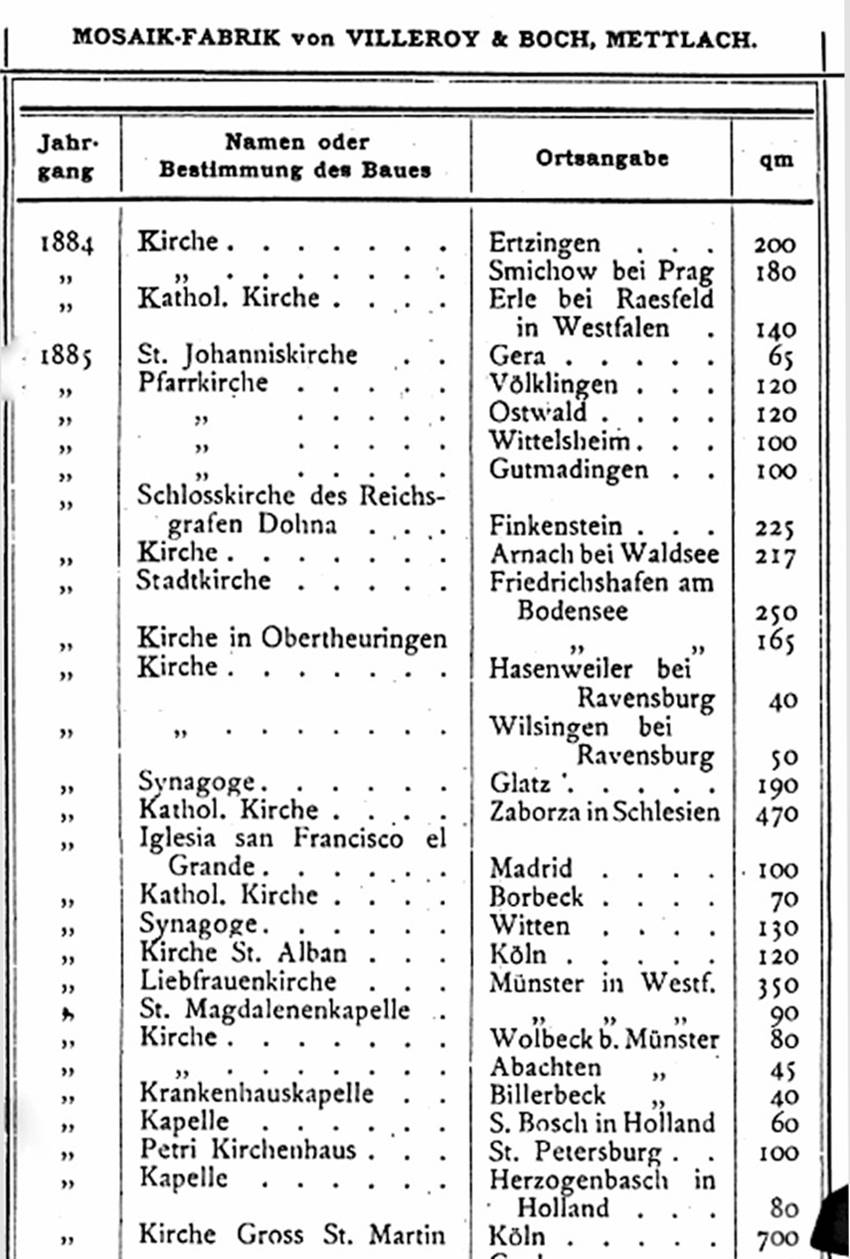 04
04
1885 wurden 700 qm Mettlacher Platten in der Kirche
Groß St. Martin verlegt.
Nach Angaben aus dem Werksarchiv von Villeroy & Boch
waren es unter anderem die folgenden Platten:
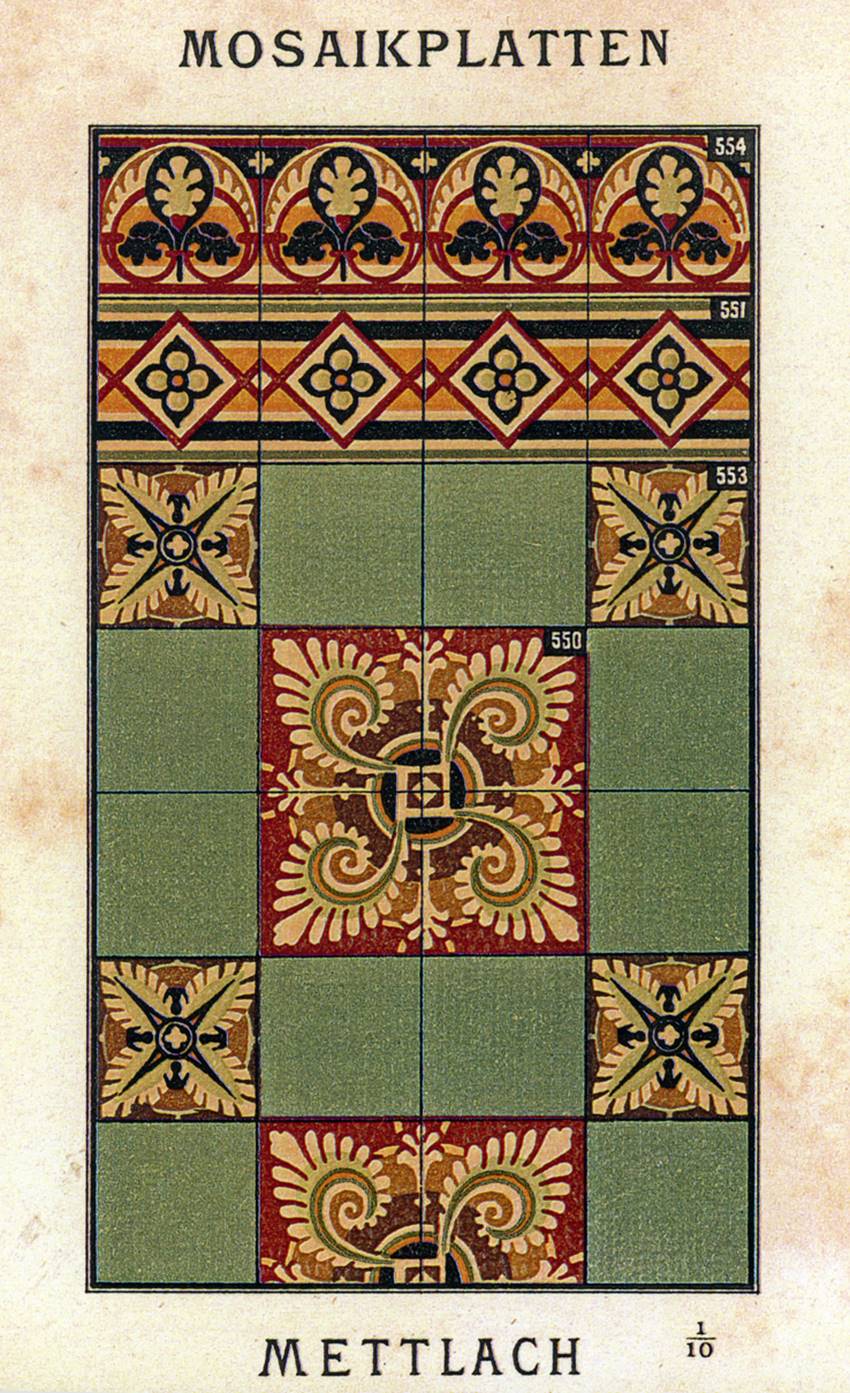 05
05
Nr. 550: Romanisches Fondmuster, röm. Imitation, Nr.
551: Romanischer Fries, röm. Imitation,
Nr. 553: Romanisches Fondmuster, röm. Imitation und Nr. 554: Romanischer
Fries, röm. Imitation.
Stiftmosaikbeläge
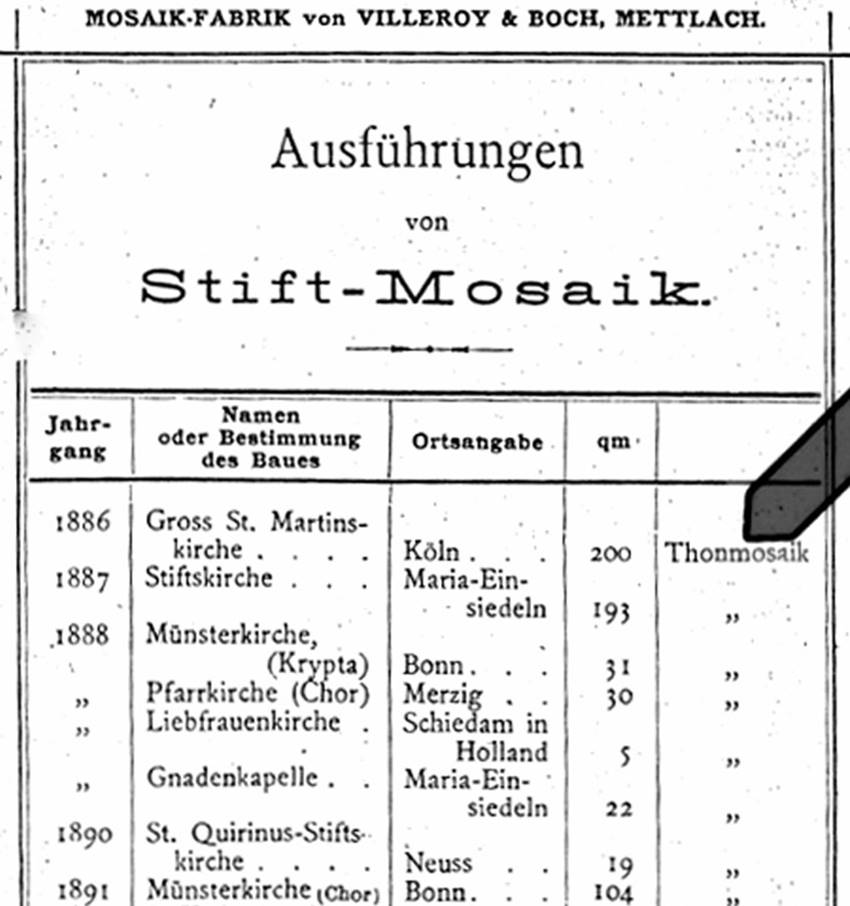 06
06
Die Angabe des Jahrgangs im Verzeichnis stimmt nicht,
denn der Bodenbelag war im September 1885 fertiggestellt
Kölnische Volkszeitung vom 06.09.1885:
„Der
Bodenbelag in St. Martin.
Der Fußboden in St. Martin, der vor kurzem fertig geworden ist, verdient
die Beachtung der Kunstfreunde in hohem Grade und dürfte zu vielen
ähnlichen Unternehmungen Anregung geben. Er ist von Villeroy und Boch in
Mettlach nach dem Plane von A. Essenwein in Nürnberg und nach Zeichnungen
von Alex. Kleinertz in Köln in Thonfliesen und Mosaik aus Thonwürfeln
hergestellt und bedeckt eine Fläche von etwa 10,000 Qu.-Fuß.“
Im Werksarchiv von Villeroy & Boch Mettlach lagern
alte Auftragsbücher. Darin findet man für Groß St. Martin die folgenden
Eintragungen:
Nr.
|
Gegenstand
|
Entworfen von
|
Besteller
|
Ort
|
Bestimmung |
ausgeführtMonat
|
Jahr
|
|
93 |
Romanische Detailzeichnungen Hirsch, Löwe, 4 Menschenalter,
Kämpfe, alte Welt, Glücksrad, 8 Seligkeiten, Schiff der Kirche,
Schiff der Seligen, die verschiedenen geistl. und weltl. Stände,
Lebensbaum, St. Johannes & Christophorus usw |
Kleinertz |
|
Köln |
St. Martin |
|
1885 |
Aus dem Werksarchiv von Villeroy & Boch Mettlach
erhielt ich Fotos nachfolgender Vorlagen für keramische Bodenbeläge in
Groß St. Martin:
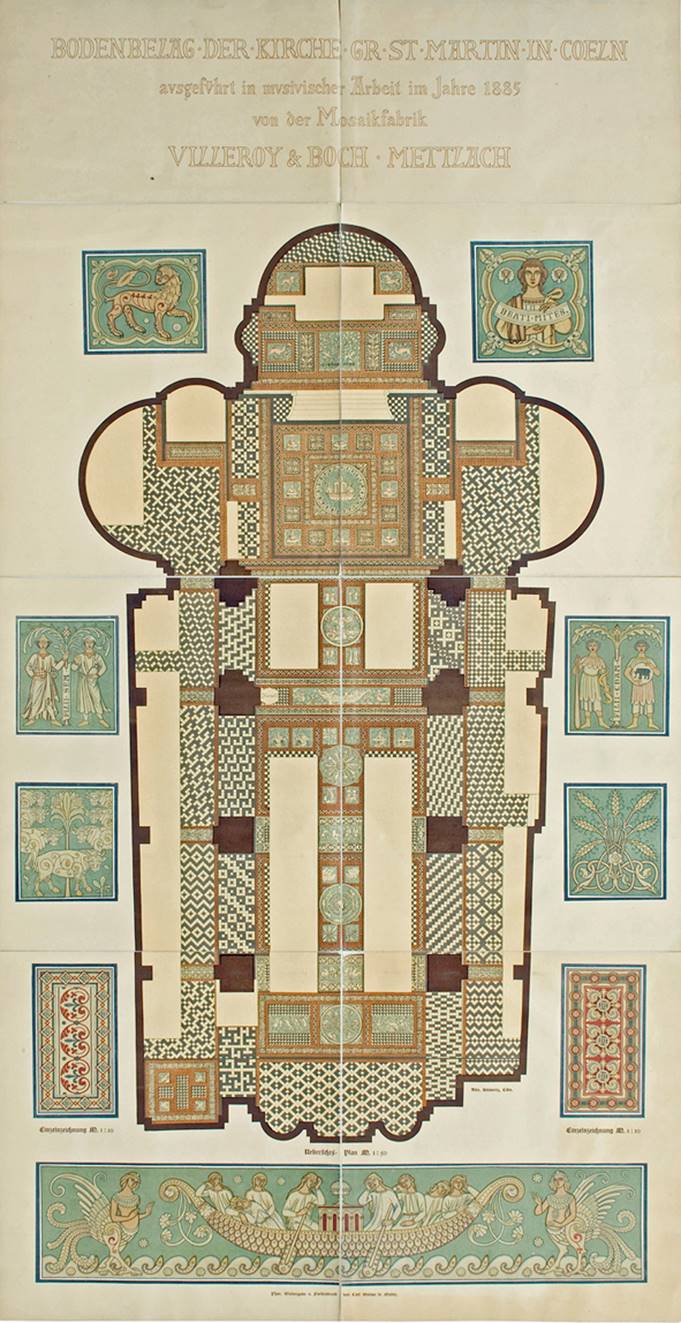 07
07
Übersichtsplan der 1885 von der Mosaikfabrik Villeroy & Boch Mettlach
ausgeführten Stiftmosaikbeläge.
Das Original ist im Maßstab 1:50 gezeichnet.
 08
08
Detail 1 des Übersichtplans (Abb. 07).
Der Stiftmosaikbelag wurde für den Hochaltar
ausgespaart.
Das große Mosaikfeld vor dem Altar zeigt einen Baum
mit zwei Vögeln und trägt die Inschrift „LIGNVM VITAE“. Der Baum des
Lebens steht im ersten Buch der Bibel, dem Buch Genesis, in engem
Zusammenhang mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.
Links und rechts zeigen Mosaikfelder Hirsche. Sie
stehen für Psalm 42,2 „Wie der
Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, Gott.“
Links und rechts neben dem Altar sieht man Mosaikfelder mit
Löwendarstellungen, das Böse symbolisierend. 1 Petrus 5,8
„Seid nüchtern und wachet; denn
euer Widersacher, der Teufel, gehet umher wie ein brüllender Löwe und
suchet, welchen er verschlinge.“
 09
09
Mosaikfeld links neben dem Detail 1 des Übersichtsplans.
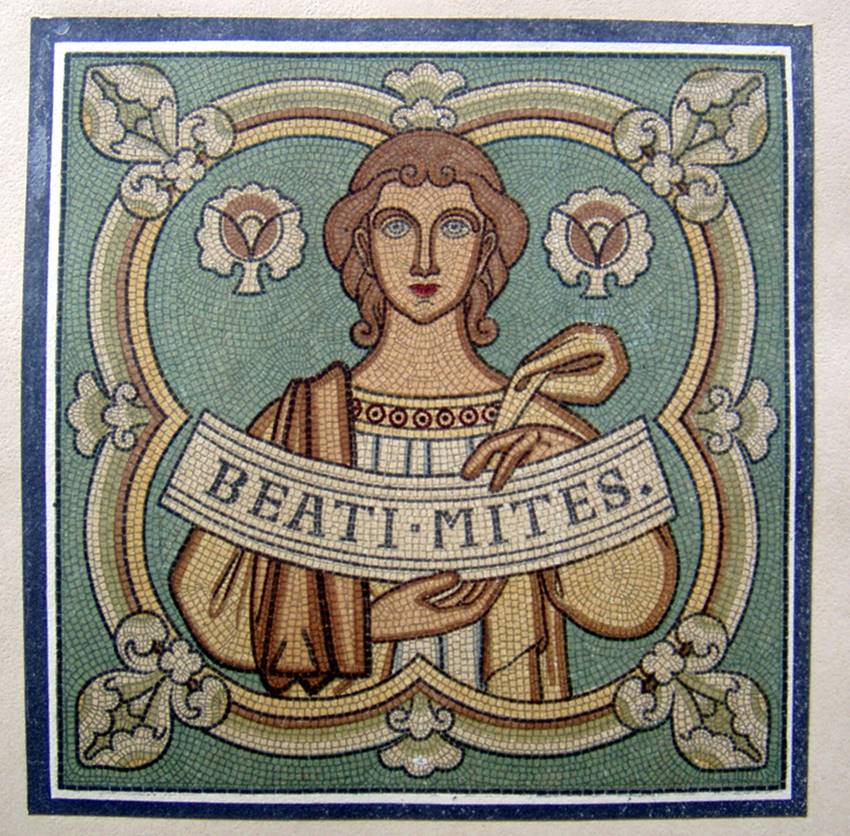 10
10
Mosaikfeld rechts neben dem Detail 1 des Übersichtsplans.
Evangelium nach Matthäus, Kapitel 5, Vers 5: „beati
mites quoniam ipsi possidebunt terram“ / „Selig sind die Sanftmütigen,
denn sie werden das Land besitzen.“
 11
11
Detail 2 des Übersichtplans (Abb. 07).
Im Chor sieht man in einer großen, von einem Quadrat
umschriebenen, Kreisfläche das Schiff der Kirche, rechts mit Papst Leo
XIII. (*1810-+1903) und links mit Erzbischof Paulus Melchers
(*1813-+1895).
In der großen Vierung stellen Engel mit Spruchbändern
die acht Seligkeiten dar (Lukas 6,20-23 und Matthäus 5,1-12).
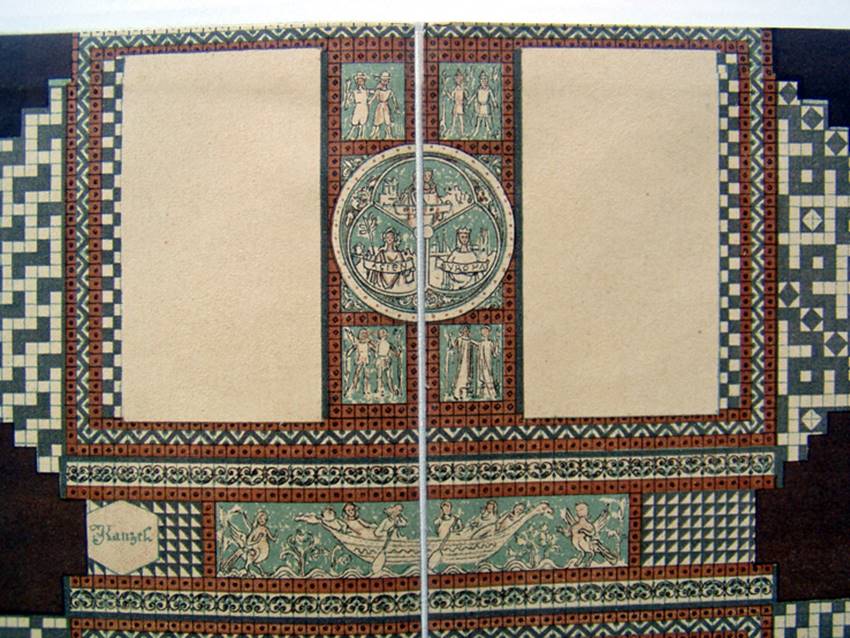 12
12
Detail 3 des Übersichtplans (Abb. 07).
Im großen Kreis sind die drei Teile der Alten Welt
dargestellt, wie sie bei Erbauung von Groß St. Martin bekannt waren. Sie
sind dargestellt als ideale Frauengestalten. Afrika mit Sonne, Mond und
Jerusalem; Asien mit dem Nil; Europa als Königin mit dem Vater Rhein und
der Martinskirche im Panorama der Stadt Köln.
 13
13
Sem, ältester Sohn Noahs mit seiner Frau.
Mosaikfeld links neben dem Detail 3 des Übersichtsplans.
Altes Testament, Genesis 10 – Die Sintflut –
„An eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem,
Cham und Jafet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen
seiner Söhne.“
Nach biblischer Vorstellung zweigten sich von den drei Söhnen Noahs,
Sem,
Ham
und
Jafet,
die Völker ab, die nach der Vernichtung der Menschheit in der
Sintflut
die Erde neu bewohnen sollten.
Dass sich die von Sem abstammenden Völker von Israel aus nach
Osten, die von Cham abstammenden in südwestlicher und die von
Jafet abstammenden in nordwestlicher
Richtung ausgebreitet hätten, war in der Zeit des europäischen
Mittelalters
bis in die
Neuzeit
und in allen von der biblischen Überlieferung beeinflussten Regionen eine
gängige Vorstellung.
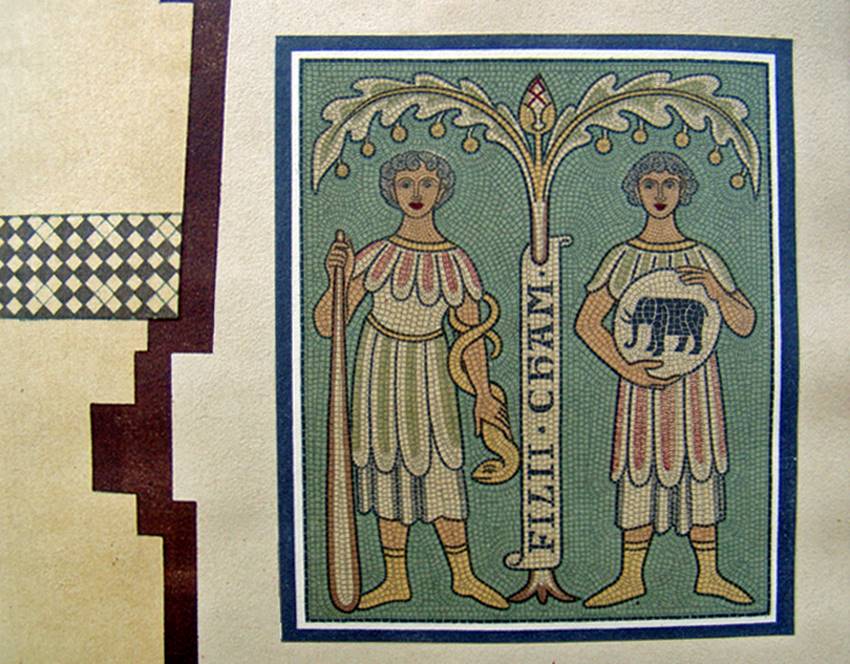 14
14
Cham, zweitältester Sohn Noahs mit seiner Frau.
Mosaikfeld rechts neben dem Detail 3 des Übersichtsplans.
 15
15
Detail 4 des Übersichtplans (Abb. 07).
Im dritten Joch bilden u.a. geistliche und weltliche
Stände die Speichen eines Rades und machen eine in sich geschlossene
Einheit aus.
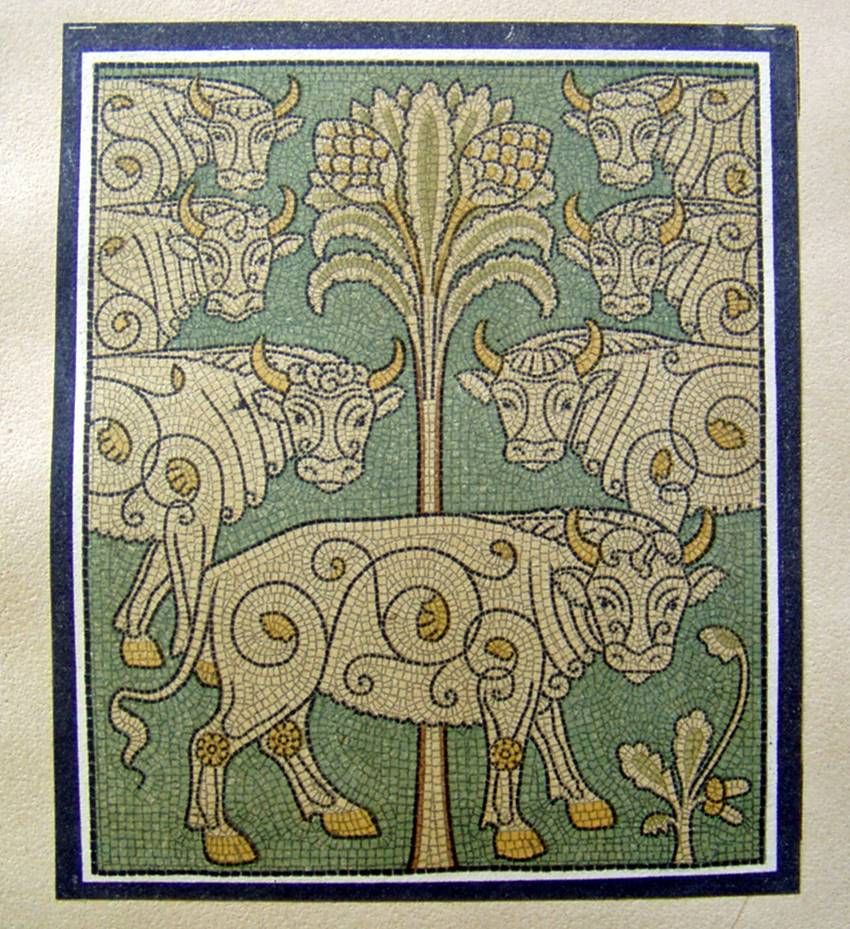 16
16
Mosaikfeld links neben dem Detail 4 des Übersichtsplans (Abb. 07).
Sieben fette und sieben magere Jahre.
Die Wendung entstammt dem Alten Testament, wo Joseph
den Traum des Pharaos von sieben fetten und sieben mageren Kühen so
auslegt, dass nun sieben ertragreiche Jahre und dann sieben Jahre mit
Hungersnot folgen werden.
 17
17
Mosaikfeld mit Ähren rechts neben dem Detail 4 des Übersichtsplans (Abb.
07).
Von Alexius Kleinertz gezeichnete Vorlage im Maßstab 1:10 im Werksarchiv
von Villeroy & Boch Mettlach.
Sieben fette und sieben magere Jahre (1. Mose
4,25-27)
Joseph antworte dem Pharao: „Die
sieben schönen Kühe sind sieben Jahre, und die sieben guten Ähren sind
dieselben sieben Jahre. Es ist ein und derselbe Traum.
Die sieben mageren und hässlichen
Kühe, die nach jenen aufgestiegen sind, das sind sieben Jahre, und die
sieben mageren und versengten Ähren sind sieben Jahre des Hungers.“
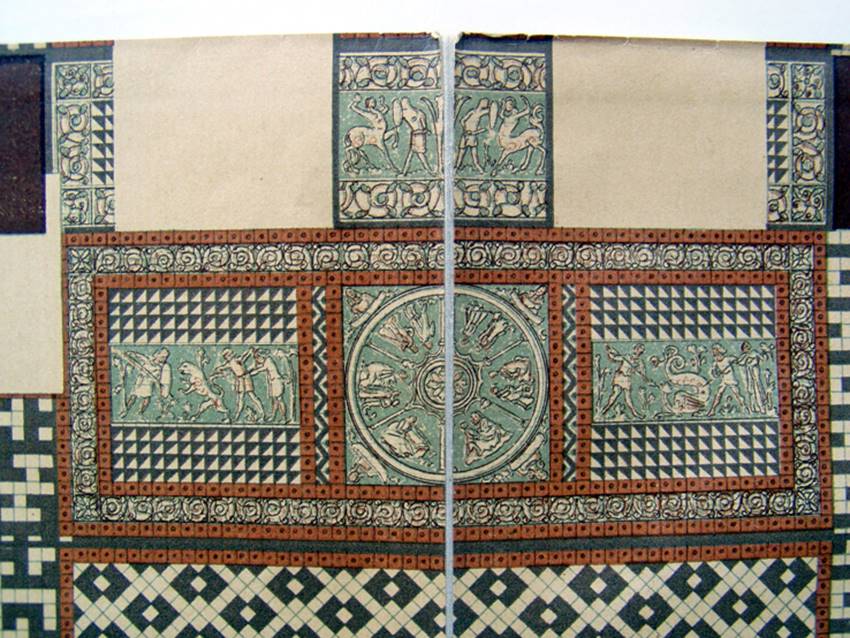 18
18
Detail 5 des Übersichtplans (Abb. 07).
Auf der Kreisfläche ist dargestellt, wie das Leben
des Menschen in verschiedenen Lebensaltern von der Wiege bis zum offenen
Sarg durchläuft.
 19
19
Mosaikfeld links neben dem Detail 5 des Übersichtsplans (Abb. 07).
Vorlagenblatt im Maßstab 1:10 im Werksarchiv von
Villeroy & Boch.
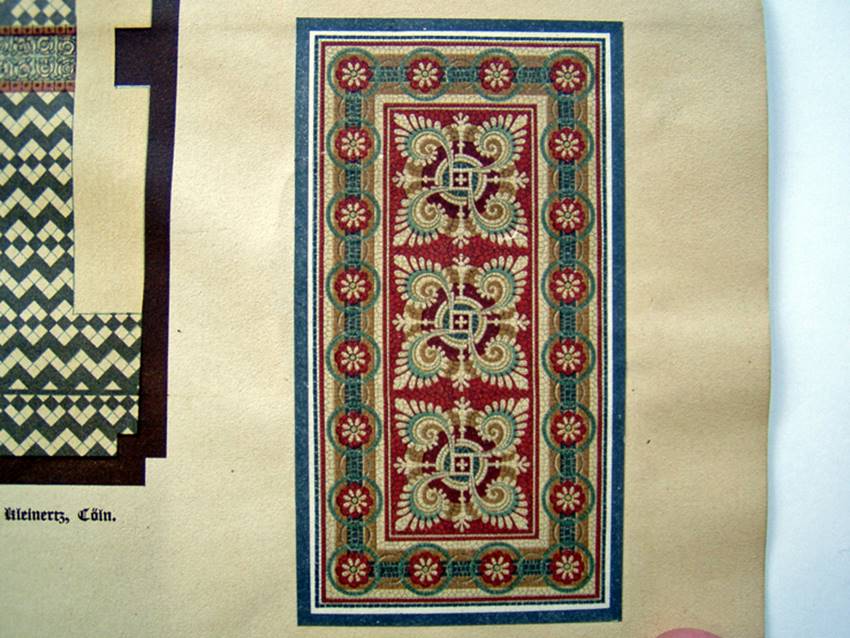 20
20
Mosaikfeld rechts neben dem Detail 5 des Übersichtsplans (Abb. 07).
Auf dem Vorlagenblatt im Werksarchiv von Villeroy &
Boch steht geschrieben, dass Alexius Kleinertz aus Cöln die
Einzelzeichnung im Maßstab 1:10 fertigte.
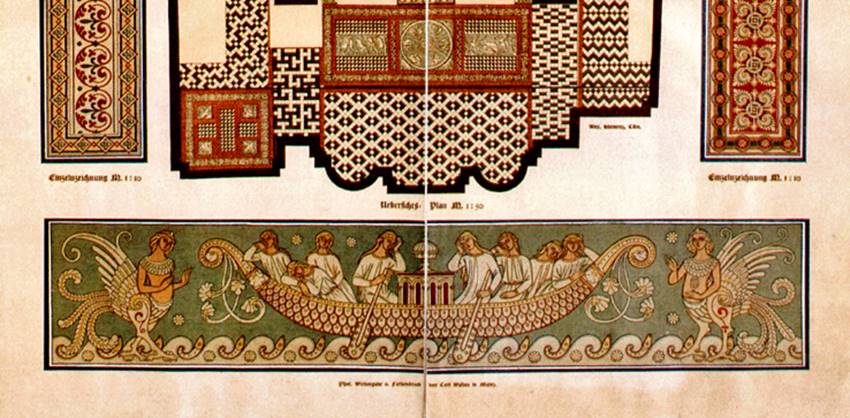 21
21
Detail 6 des Übersichtplans (Abb. 07).
Im Kreis sieht man das Glücksrad. Der Mensch greift
nach der Krone; einen Augenblick besitzt er sie, dann fällt sie und er
selbst stürzt ihr nach: Streben und Verlieren und höchstens kurzer Besitz.
Aber nicht Fortuna schwingt dieses Rad, sondern Gott. Deshalb steht in der
Mitte des Kreises: „Deus est in rota“, Gott ist es, der das Rad beherscht.
Diese Darstellung findet man übrigens auch im später von Villeroy & Boch
ausgeführten Kölner Dommosaik.
Ein breiter Fries vor der Völkertafel stellt dar, wie
der Mensch sich zu hüten hat, daß er sich nicht von den Sirenenstimmen der
Welt zur Untätigkeit einschläfern lasse. Acht Personen sind bei
nächtlicher Fahrt in einem schmalem Schiff, worauf der Schatz in
zerbrechlichem Gefäß steht, beim Gesange von Sirenen eingeschlafen, die
Ruder ruhen, der Schiffbruch steht bevor.
Zerstörung
und Wiederaufbau
Die Kirche Groß St. Martin wurde im Zweiten Weltkrieg
nahezu gänzlich zerstört.
Unter Leitung des Architekten Herbert Molis und des Statikers Wilhelm
Schorn begannen schon 1948 erste Wiederaufbau- und Sicherungsarbeiten. Bis
1954 erhielten die Konchen ihre Zwerggalerien - provisorisch mit Ziegeln
gemauert - zurück. Ab 1955 wurde mit dem Wiederaufbau des Langhauses
begonnen,. Seit 1961 zeichneten die Kölner Architekten Joachim und Margot
Schürmann für die weitere Erneuerung von Bau und Ausstattung
verantwortlich. Ihr Konzept gilt als maßgeblich für den heutigen Zustand
der Kirche. Der Vierungsturm erhielt 1965 seine alte Gestalt und damit
Köln ein wichtiges Wahrzeichen zurück. Das Langhaus wurde bis 1971 wieder
mit Westwand und Dach versehen.
Bergung von
Mosaikplatten- und Stiftmosaikböden
Bei der Schuttbeseitigung legte man Reste der
Mosaikplatten- und Stiftmosaikböden frei.
Im April 1976 wurde die Firma Hein Derix, Werkstätten für Glasmalerei,
Mosaik und Restaurierungsarbeiten aus Kevelaer beauftragt, eine
Situationsbeschreibung zur Vorbereitung von Sicherungsarbeiten der
freigelegten keramischen Beläge im Chor- und Vierungsbereich zu verfassen.
Im Mai 1976 erhielt die Firma Hein Derix den Auftrag zur Sicherung der
fünf Mosaike im Chorbereich, von neun Mosaike im Bereich der Vierung und
für die Grabplatte des Bischofs Joseph Schmitz. Der Auftrag beinhaltete
weiterhin die Sicherung von ca. neunhundert Mettlacher Mosaikplatten im
Format von 17 x 17 cm.
Im Januar 1982 holten Mitarbeiter der Firma Derix
noch ein Mosaik mit Halbfigur und dem Schriftband „BEATI QVI ESVRIVNT ET
SITIVNT IVSTITIAM“ vom Schnütgen-Museum zur Kirche Groß St. Martin, wo es
nach der Bergung aus der zerstörten Kirche zwischengelagert war.
Mosaikplatten
Mitarbeiter der Firma Hein Derix aus Kevelaer bargen
824 Mosaikplatten im Format von jeweils 17 x 17 cm. Diese Arbeiten wurden
am 17.09.1976 abgeschlossen. Alle Mosaikplatten zu sichern, konnte aus
Kostengründen nicht entsprochen werden. Der Verbleib der gesicherten und
ungesicherten Mosaikplatten ist mir nicht bekannt.
Skizze zur
Lage von Stiftmosaikflächen im Chorbereich
(Angegeben sind jeweils Darstellung und ob restauriert oder neu erstellt)
|
|
Osten |
|
|
Norden |
|
Süden |
|
|
Westen |
|
Skizze zur
Lage von Stiftmosaikflächen in der Vierung
(Angegeben sind jeweils Darstellung und ob restauriert oder neu erstellt)
|
|
Osten |
|
|
Norden |
|
Süden |
|
|
Westen |
|
In der Zeit von 1982 bis 1984 erfolgte die Verlegung der neuen Fußböden. Architekt in dieser Zeit war Joachim Schürmann.
Die Mosaikfelder 6 bis 21 umgeben den Vierungsaltar.
Dieser steht an der Stelle, an der bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg
in einer großen, von einem Quadrat umschriebenen, Kreisfläche das Schiff
der Kirche, in Stiftmosaik ausgeführt, lag (Abbildung 11).
Fotodokumentation vom
12. Mai 2018
 24
24
Blick nach Osten über den Vierungsaltar zum Chorbereich
 25
25
Blick aus der Nordkonche zum Chorbereich und zum Vierungsaltar
 26
26
Hirsch (restauriert) links im Chorbereich
Das Mosaikfeld hat die Maße 1,36 x 1,02 m.
 27
27
Hirsch (restauriert) rechts im Chorbereich
Das Mosaikfeld hat die Maß3 1,36 x 1,02 m.
Nicht
restaurierte Originale 1885 verlegter Mosaikflächen im neuen Bodenbelag
 28
28
Die Brigidenkapelle
Mauerreste zeugen von der ab 1803 abgerissenen
Pfarrkirche St. Brigida, die sich mit der Abteikirche St. Martin einen
Teil derer Südwand teilte.
Im Bodenbelag wurde durch die Firma Hein Derix,
Werkstätten für Glasmalerei, Mosaik und Restaurierungen aus Kevelaer, ein
Fragment des originalen Fußbodenmosaiks ‚sieben fetten Kühe‘ integriert
(siehe Abbildung 16).
 29
29
Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln, RBA 154 142 (Vierung, Ostkonche)
Das Foto zeigt dieses Fragment der 1885 durch die
Firma Villeroy & Boch verlegten Mosaikflächen nach Beseitigung der
Trümmer.
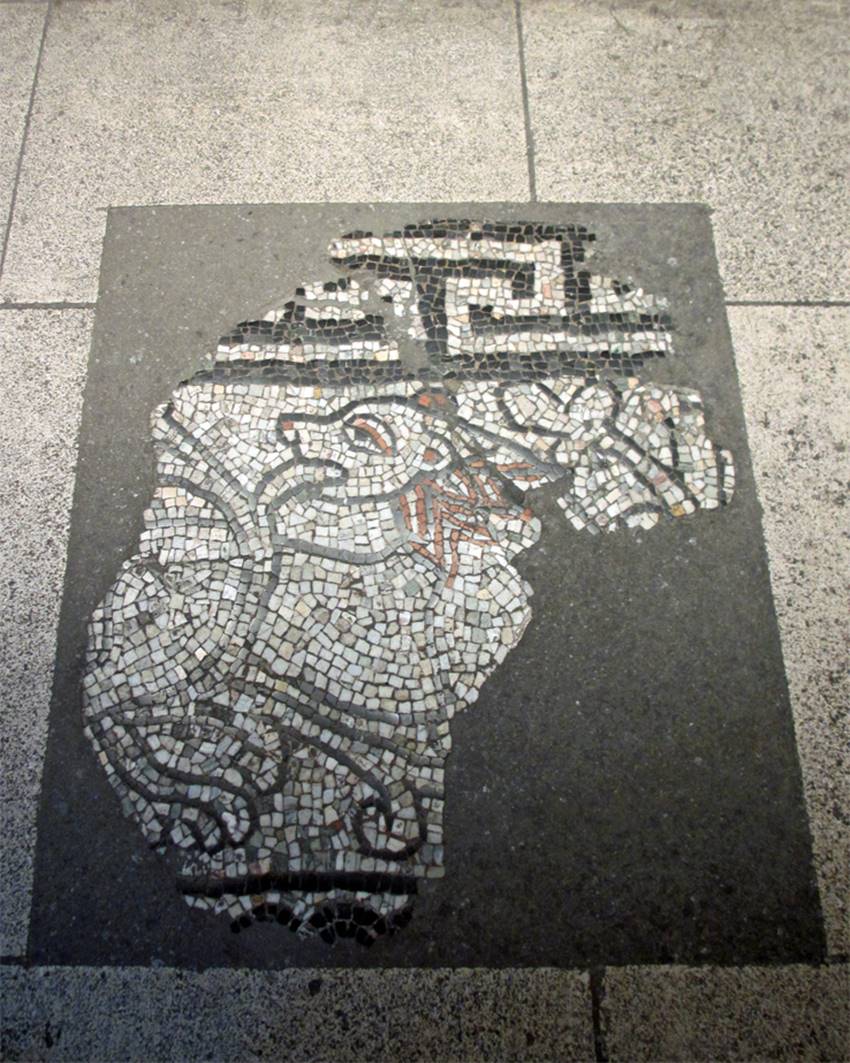 30
30
Im
Bodenbelag der Kirche wurde ein Fragment des originalen Fußbodenmosaiks
integriert
Stiftmosaikflächen am Altar in der Vierung
(Auflistung der Flächen unter Abbildung 23)
 31
31
Mosaikflächen 6-10
 32
32
Mosaikfläche 9 (neu), Ornament 1
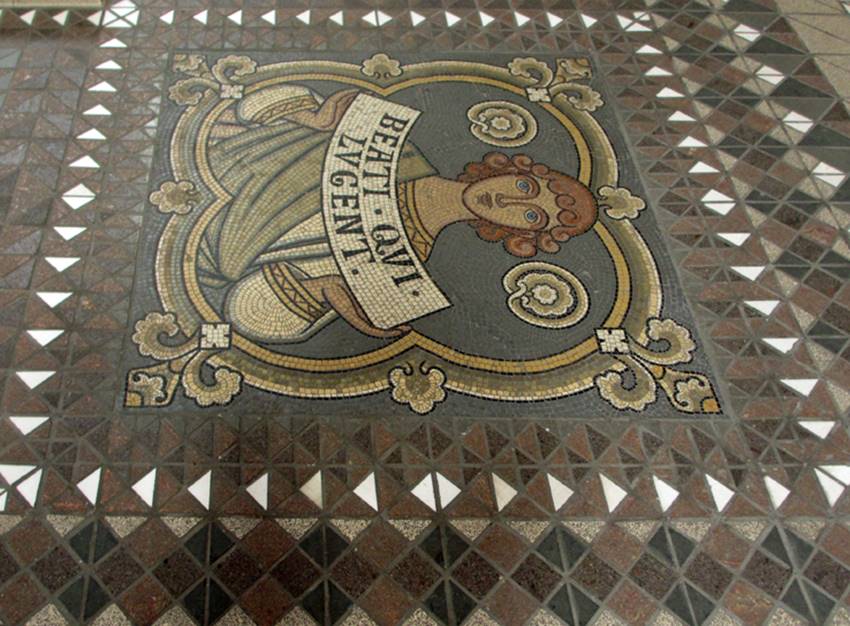 33
33
Mosaikfläche 10 (restauriert), BEATI QVI LVGENT
 34
34
Mosaikflächen 10-6
 35
35
Mosaikfläche 12 (neu), Ornament 2
 36
36
Mosaikfläche 14 (restauriert), BEATI MISERICORDES
 37
37
Mosaikfläche 15 (restauriert), Ornament 2
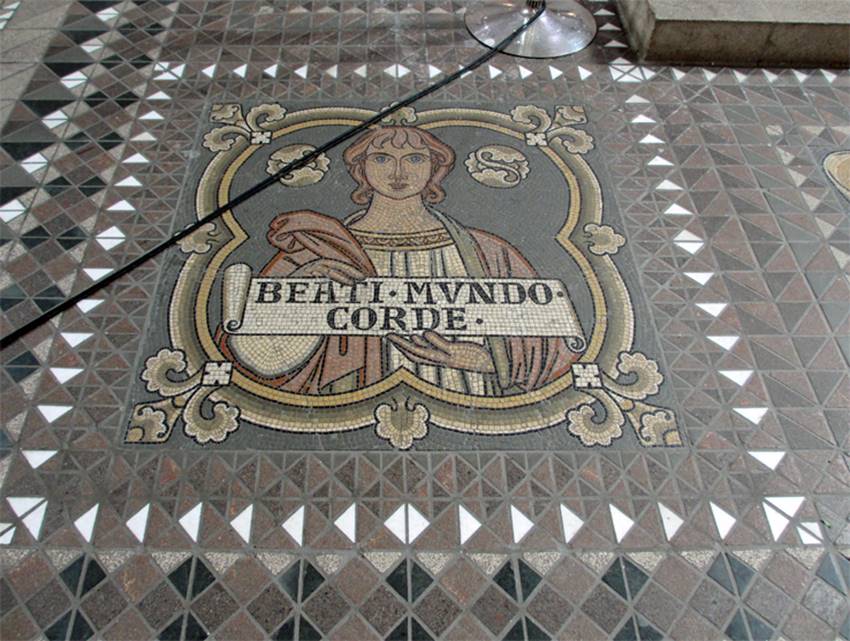 38
38
Mosaikfläche 17 (restauriert), BEATI MVNDO CORDE
 39
39
Mosaikfläche 18 (restauriert), Ornament 1
 40
40
Mosaikfeld 19 (neu), BEATI PACIFICI
 41
41
Mosaikfeld 20 (neu), Ornament 1
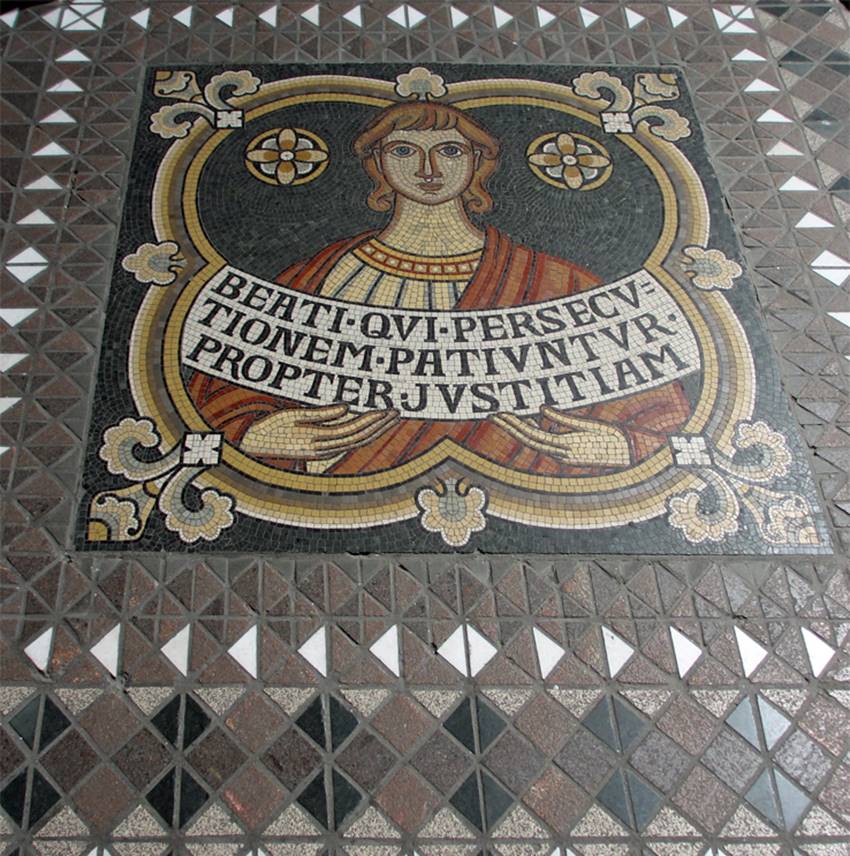 42
42
Mosaikfeld 21 (neu), BEATI QVI PERSECVTIONEM …
Mosaikfelder
mit Löwendarstellungen, das Böse symbolisierend
Neues Testament 1 Petrus 5,8
„Seid nüchtern und wachet; denn
euer Widersacher, der Teufel, gehet umher wie ein brüllender Löwe und
suchet, welchen er verschlinge.“
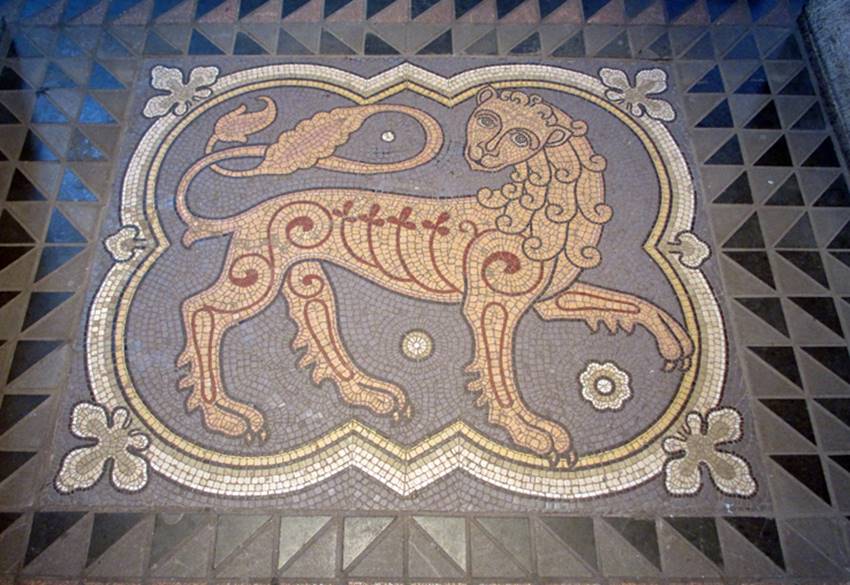 43
43
Darstellung eines nach rechts schreitenden Löwen (restauriert) im
Bodenbelag der Kirche integriert
(Siehe Abbildungen 08 und 09)
Das Mosaikfeld hat die Maße 1,02 x 0,85 m.
 44
44
Darstellung eines nach links schreitenden Löwen (restauriert) im
Bodenbelag der Kirche integriert
(Siehe Abbildung 08)
Das Mosaikfeld hat die Maße 1,02 x 0,85 m.
Mosaikfelder
der acht Seligpreisungen
(Evangelist Lukas
Kapitel 6,20-23 und Evangelist Matthäus, Kapitel 5,1-12)
|
|
1. beati pauperes spiritu
quoniam ipsorum est
regnum caelorum consequentur
1. Selig die
Armen im Geist; denn ihrer ist das Himmelreich.
(6) Größe: 0,96
x 1,03 m
Zustand des
Originals: „befriedigend,
untere Seite des Bildes stark zerstört.“
Die
Restaurierung wurde am 30.11.1982 abgeschlossen.
|
|
|
2. beati qui lugent
quoniam ipsi
consolabuntur
2. Selig die
Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
(10) Größe:
0,96 x 1,03 m
Zustand des
Originals: „befriedigend,
an der rechten Seite stark zerstört.“
Die
Restaurierung wurde am 30.01.1983 abgeschlossen. |
|
|
3. beati mites
quoniam ipsi possidebunt
terram
3. Selig die
Sanftmütigen; denn sie werden das Land als Erbe besitzen.
(8) Größe: 0,96
x 1,03 m
Zustand des
Originals: „zerstört.“
Die
Neuanfertigung wurde am 28.02.1983 abgeschlossen. |
|
|
|
|
|
4. beati qui esuriunt et
sitiunt iustitiam
quoniam ipsi saturabuntur
4. Selig, die
hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden
gesättigt werden.
(13) Größe:
0,96 x 1,03 m
Zustand des
Originals: „befriedigend, an der rechten Seite und am unteren
Bildrand stark ausgebrochen.“
Die
Restaurierung erfolgte in mehreren Schritten. |
|
|
5. beati misericordes
quia ipsi misericordiam
5. Selig die
Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.
(14) Größe:
0,96 x 1,03 m
Zustand des
Originals: ohne Angabe
Die
Restaurierung wurde am 30.01.1983 abgeschlossen. |
|
|
6. beati mundo corde
quoniam ipsi Deum
videbunt
6. Selig, die
ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.
(17) Größe:
0,96 x 1,03 m
Zustand des
Originals: „gut“
Die
Restaurierung erfolgte in mehreren Schritten. |
|
|
7.beati pacifici
quoniam filii Dei
vocabuntur
7. Selig die
Friedenstifter; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.
(19) Größe:
0,96 x 1,03 m
Zustand des
Originals: „stark zerstört,
müßte in drei Fragmenten gesichert werden.“
Die
Neuanfertigung wurde am 10.04.1983 abgeschlossen. |
|
|
8. beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam
8. Selig, die
Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen; denn ihrer ist das
Himmelreich.
(21) Größe:
0,96 x 1,03 m
Zustand des
Originals: „stark zerstört“
Die
Neuanfertigung wurde am 15.04.1983 abgeschlossen.
|
Stilisierte
Ornamente
Alle acht Mosaikflächen haben das Format 0,68 x 0,68 m.
7
Zustand des Originals:
„befriedigend“, die Restaurierung wurde am 02.02.1982 abgeschlossen.
9
Zustand des Originals: „stark
zerstört“, die Neuanfertigung wurde am 20.01.1983 abgeschlossen.
11
Zustand des Originals: „stark
zerstört“, die Neuanfertigung wurde am 20.01.1983 abgeschlossen.
12
Zustand des Originals: „stark
zerstört“, die Neuanfertigung wurde am 28.02.1983 abgeschlossen.
15
Zustand des Originals:
„befriedigend“, die Restaurierung wurde am 28.02.1983 abgeschlossen.
16
Zustand des Originals:
„befriedigend“, die Restaurierung wurde am 28.02.1983 abgeschlossen.
18
Zustand des Originals: „mehrfach
gerissen“, die Restaurierung wurde am 15.12.1982 abgeschlossen.
20
Zustand des Originals: „stark
zerstört“, die Neuanfertigung wurde am 15.04.1983 abgeschlossen.
Benutzte
Literatur
Wikipedia
Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Neuss 1989
Fotonachweis
01 - 03 Wikipedia
04 – 21 Werksarchiv der Villeroy & Boch AG Mettlach
29 Rheinisches Bildarchiv Köln, RBA 154 142
Alle anderen Fotos und Skizzen vom Verfasser
Kontakt
Gemeinschaft
der Schwestern und Brüder von Jerusalem in Köln
An Groß St.
Martin 9
50667 Köln
Mein Dank gilt
Frau Agnes Müller, Leiterin des Werksarchivs von
Villeroy & Boch in Mettlach, die mir Fotos von Vorlagen für keramische
Bodenbeläge in Groß St. Martin zur Verfügung stellte,
Herrn Peter Derix, Werkstätten für Glasmalerei, Mosaik und Restaurierungen aus Kevelaer, für die Überlassung von Kopien die Restaurierung betreffender Unterlagen und meinem Sohn Norbert für die Bearbeitung und Veröffentlichung des Berichtes.
In den Jahren 1887 und 1888 verlegte Villeroy & Boch
„Bodenbeläge aus Mettlacher Tonstiftmosaik in der
Stiftskirche Einsiedeln / Schweiz“
www.geschichte-der-fliese.de/einsiedeln_tonstiftmosaik.html
Vier Jahre nach Fertigstellung der keramischen
Bodenbeläge in der Kirche Groß St. Martin begann die Firma Villeroy & Boch
aus Mettlach mit der Fertigung und Verlegung der Stiftmosaikbeläge im
Kölner Dom. Die Arbeiten dauerten von 1889 bis 1898.
„Fußboden-Mosaiken im Kölner Dom“